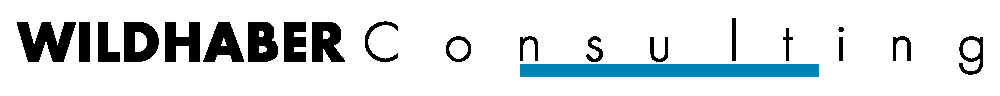Weshalb das System radikal neu gedacht werden muss (Zusammenfassung)
Das Elektronische Patientendossier (EPD) der Schweiz ist gescheitert. Die Zahl aktiver Dossiers liegt bei rund 70’000 – in einem Land mit über 8 Millionen Einwohnern. Die Akzeptanz? Gegen null. Statt am toten Pferd EPD herumzudoktern, braucht es einen klaren Schnitt – und einen grundlegend neuen Ansatz.
Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit dem EPD, ursprünglich vor allem im Zusammenhang mit Sicherheitsfragen. Damals war ich begeistert: Endlich dachte jemand frühzeitig über Datenschutz und Zugriffskontrolle nach. Doch bald wurde klar – selbst die beste Sicherheit nützt nichts, wenn niemand weiss, wie das System zu bedienen ist oder was es bringen soll. Die dezentrale Architektur mag sicherheitstechnisch sinnvoll gewesen sein, stellte technisch aber eine riesige Hürde dar. Die Folge: exorbitante Kosten bei praktisch null Nutzen. Die heutigen EPD-Lösungen sind benutzerunfreundlich, veraltet und wirken wie aus den 1980er-Jahren.
Der Bund plant nun, das EPD-Gesetz zu revidieren und neue technische Ansätze vorzuschlagen. Doch auch diese Reform wird scheitern, wenn nicht endlich die zentralen Fragen gestellt werden: Wer nutzt das EPD – und warum überhaupt? Heute sind es vor allem technikaffine Menschen und Fachleute mit Interesse an Gesundheits-IT. Die breite Bevölkerung – die eigentlich profitieren sollte – bleibt draussen. Für sie ist das EPD ein technisches Kuriosum ohne Mehrwert.
Niemand kauft freiwillig die zweite Version eines Produkts, dessen erste Version schon ein kompletter Flop war.
Der Begriff «EPD» ist verbrannt – Marketingtechnisch nicht mehr zu retten. Ein EPD 2.0 suggeriert Kontinuität, wo ein kompletter Neuanfang nötig wäre. Neue Technik allein bringt nichts, solange nicht die grundlegenden Anreizsysteme überdacht werden. Selbst bei einer Pflicht zur Nutzung durch Leistungserbringer bleibt die zentrale Frage ungelöst: Worin besteht der persönliche Nutzen für alle Beteiligten? Heute: Inexistent.
Nur wer einen klaren Vorteil sieht – ökonomisch oder gesundheitlich – wird Gesundheitsdaten aktiv nutzen oder teilen. Ich spreche als Patient: Ich habe keinen Anreiz, ein EPD zu eröffnen. Technisches Interesse? Vielleicht. Konkreter Nutzen? Fehlanzeige.
Vergessen wir den Begriff EPD. Streichen wir ihn aus unserem Wortschatz. Was wir brauchen, ist ein digitales Gesundheitswesen, das echten Nutzen stiftet – für Patientinnen, Leistungserbringer und alle anderen Akteure. Die Nutzung von Gesundheitsdaten muss zu einer spürbaren Verbesserung der Versorgung führen.
Chronische Krankheiten verursachen über 80 % der Gesundheitskosten in der Schweiz. Genau hier liegt das Potenzial: Daten können helfen, chronisch Kranke besser zu betreuen, Komplikationen zu vermeiden und Kosten massiv zu senken. Aber dafür braucht es ein datenbasiertes System mit echten Anreizen – nicht ein Papiertiger namens EPD 2.0.
Robert Pearl, Ex-CEO von Kaiser Permanente, hat am Forum 2025 des Gesundheitsdatenraums (gesundheitsdatenraum.ch) gezeigt, was möglich ist: Mit KI, digitalen Tools und Capitation-Modellen lassen sich Milliarden sparen – und gleichzeitig Qualität und Patientenzufriedenheit erhöhen. In Capitation-Modellen erhalten Ärztinnen eine Pauschale pro Versicherten – und verdienen dann am meisten, wenn ihre Patientinnen gesund bleiben. Das ist das Gegenteil unseres Systems, das Krankheit belohnt und Prävention ignoriert.
Die konservative Schätzung: 10–20 % Einsparung bei den Kosten chronischer Krankheiten – das sind bis zu 15 Milliarden Franken jährlich. Und das mit besserer Versorgung. Das heutige System ignoriert chronisch Kranke, obwohl diese den Löwenanteil der Kosten verursachen. Ein datenbasiertes, patientenzentriertes Modell wie bei Kaiser Permanente oder Buurtzorg in den Niederlanden zeigt: Es geht – wenn man will.
Daten entstehen nicht nur beim Arztbesuch – sie entstehen im Alltag. Die Patientin muss dabei im Zentrum stehen, sie besitzt ihre Daten, sie entscheidet über deren Nutzung. Je transparenter sie ihre Daten teilt, desto grösser der Nutzen – für sie selbst und das System. Mit heutigen Technologien lassen sich selbstverwaltete Gesundheitsnetzwerke bauen, die Versicherung, Versorgung und Datenhoheit verbinden. Dogmatische Debatten über Standards sind überflüssig – gebaut wird bottom-up, pragmatisch, schlank.
Fazit: Ein EPD 2.0 spart keinen Rappen. Was es braucht, ist ein radikaler Umbau. Vom Patienten her gedacht, digital, ökonomisch sinnvoll und endlich mit echtem Anreiz zur Prävention. Wer glaubt, mit ein paar Gesetzesrevisionen sei das Problem gelöst, hat die Realität verpasst.
PS: Die übliche Kakophonie aus Politik, Verwaltung und Lobbyverbänden verdient kein weiteres Wort. In 50 Jahren hat dieses Bermuda-Dreieck keinen einzigen Franken bei den Gesundheitskosten gespart. Die Lösung kommt von unten – oder gar nicht. Wenn die Prämien weiter explodieren, wird die Revolution unausweichlich.
PPS: Das ist keine offizielle Stellungnahme des Gesundheitsdatenraums Schweiz sondern enthält ausschliesslich die persönlichen Meinung des Autors